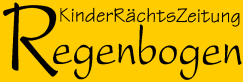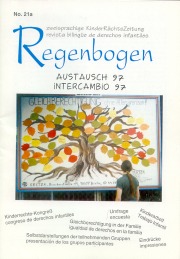<< zurück zur
Ausgaben-Übersicht
Ausgabe 21a
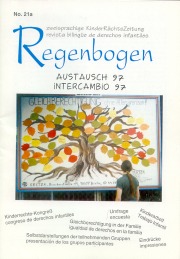

|
Was bedeutet Gleichberechtigung in der Familie?
Vorbemerkung: Im Spanischen werden die beiden deutschen Begriffe
"Erziehung" und "Bildung" meistens mit dem einen Wort "educación"
übersetzt. Dies bringt für diesen Artikel ein Mißverständnis
mit sich: Bildung und Erziehung sind zwei ganz unterschiedliche, deutlich
voneinander zu trennende Tätigkeiten. Während "Bildung" sich
auf das Lernen bezieht und es mit diesem Begriff immer möglich ist,
das aktiv lernende Subjekt in den Vordergrund zu stellen ("sich bilden"),
bleibt dies bei dem Begriff "Erziehung" ausgeschlossen, weil er immer ein
passives Objekt der Erziehung fordert (wie in diesem Artikel gleich näher
erläutert wird) und weil es hier um charakterliche Formung des Menschen
geht. Gegen "Bildung" wird niemand etwas haben, solange sie einem nicht
aufgezwungen wird, wie das aus "erzieherischen Gründen" geschieht.
Sollte also in der Übersetzung dieses Artikels "educación"
kritisiert werden, gilt diese Kritik nicht dem Teil seiner Bedeutung, der
das deutsche Wort "Bildung" beschreibt, sondern dem, der "Erziehung" meint.
Ich wette, Pink Floyd haben dasselbe gemeint, als sie gesungen haben "We
don’t need no education". (Ich bin gespannt, wie der Übersetzer diese
Vorbemerkung übersetzen will...)
Damit Kinder und Eltern gleichberechtigte Beziehungen miteinander
führen können, muß eine vordemokratische Vorstellung aus
den Köpfen der Erwachsenen verschwinden: die Vorstellung, daß
man Kinder erziehen muß.
(1) Die Erziehungsideologie: "Erziehung" bezeichnet nicht
jeden Einfluß, dem Kinder ausgesetzt werden, sondern nur geplante
(absichtliche) Einflüsse, die etwas im Kind erreichen wollen, sie
ist also gezielte Beeinflussung des Willens von Kindern. Ziel der Erziehung
ist es, Menschen zu verbessern. Im Lexikon steht: "Erziehung ist die planmäßige
Tätigkeit zur Formung junger Menschen."
Diese Ideologie erklärt Kinder zu "erziehungsbedürftigen
Wesen": Ein Neugeborenes ist demnach nicht schon ein eigenständiges
Subjekt (gleichwertiger Mensch), sondern wird es erst durch Erziehung.
Getrennt wird dann automatisch zwischen Erziehungssubjekten (Erziehern)
und Erziehungsobjekten (Zöglingen, zu Erziehenden). Erziehung ist
also nie ein auf Gegenseitigkeit beruhender Austausch, sondern immer ein
von oben nach unten verabreichter Vorgang. Die Erzieher machen sich ein
Bild, wie das betreffende Kind sein soll und versuchen dann, die Kinder
nach diesem Bild zu formen.
Dafür werden von den Erziehern bestimmte Erziehungsmittel eingesetzt,
die ausnahmslos auf zwei grundsätzliche Durchsetzungsmöglichkeiten
zurückgreifen. Zur Verfügung stehen einserseits Verführung
durch versprochene Belohnung (bei Erziehungsideologen "Motivation" genannt)
oder, wenn dies nicht wirkt, Erpressung durch angedrohte Strafen, also
Gewalt (im Erziehungsjargon "Konsequenz"). Beide Methoden stellen sich
als unfair und undemokratisch heraus, solange sie nicht als Notwehr eingesetzt
werden (von der bei Erziehung keine Rede sein kann).
Erziehung geht von der "Machbarkeit" von Menschen aus, von der Möglichkeit,
Menschen zu verbessern und charakterlich zu formen.
(2) Die Gegentheorie Antipädagogik: Antipädagogisch
eingestellte Menschen dagegen betrachten alle Menschen von Geburt an als
gleichwertig. Nach dieser Gegentheorie gibt es zwar besseres Wissen, aber
keine besseren Menschen. Deswegen kann man Menschen auch nicht bessern,
sondern höchstens Fehler, die sie machen, verbessern.
Antipädagogik unterstreicht die von Erziehungsideologen übersehene
Subjekthaftigkeit von Menschen und hält es für grundsätzlich
undemokratisch, sie als Objekte von Erziehung anzusehen. Die von Erziehungswissenschaftlern
unterstellte Erziehungsbedürftigkeit stelle sich nach genauer Betrachtung
als sich selbst erfüllende Prophezeiung heraus: Erst wenn man Kinder
als Objekte betrachtet, ihnen ihre Rechte auf Selbstbestimmung und Anerkennung
ihrer Autonomie verwehrt, entstehen unselbständige, verantwortungslose
Menschen, die dann wiederum als Argument für mehr Erziehung gelten
sollen.
Statt dessen schlagen antipädagogische Aufklärer einen gleichberechtigten
Umgang mit Kindern von Anfang an vor: Aus der Tatsache, daß Kinder
viele Fähigkeiten noch nicht entwickelt haben (in vielen Bereichen
also "schwächer" sind als Erwachsene), läßt sich zukünftig
nicht mehr ableiten, daß man ihnen Selbstbestimmungsrechte vorenthält
(z.B. zu entscheiden, wann sie ins Bett gehen wollen). Vielmehr sind Kinder
aufgrund ihrer Schwäche auf Verstärkung ihrer Rechte angewiesen,
auf Unterstützung und Hilfe.
Grundbedingung für die Gleichberechtigung in der Familie ist also,
daß Eltern ihren Erziehungsanspruch zurückstellen. Dafür
ist antipädagogische Aufklärung notwendig, die die Erziehungsideologie
als menschenunwürdig und demokratiefeindlich entlarvt. Frieden zwischen
den Generationen ist mit Erziehung nicht möglich.
Benjamin Kiesewetter

|