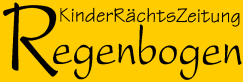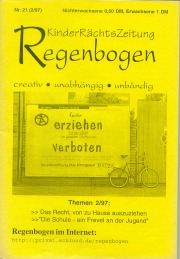<< zurück zur
Ausgaben-Übersicht
Ausgabe 21
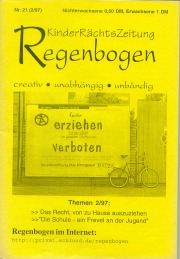

|
Gleichberechtigung in der Familie
Erfahrungen, Überlegungen und Schwierigkeiten
beim Verzicht auf Erziehung
Als Mutter von 2 Kindern (17 und 15 Jahre alt), die seit Jahren in
der Kinderrechtsbewegung aktiv sind und die Gleichberechtigung für
Kinder fordern, möchte ich mitteilen, was das für mich bedeutet.
Die Idee der Gleichberechtigung zwischen Kindern und Erwachsenen hat
in den letzten Jahren durch die Überzeugungskraft meiner Kinder und
die Lektüre bestimmter Autoren (besonders E.v.Braunmühl) in meinem
Denken mehr und mehr Raum eingenomnmen. Es ist aber immer noch ein Prozeß.
Manche neue Situation kann wieder die Angst hervorrufen, daß die
Verantwortung, die meine Kinder tragen müssen, zu schwer ist. Schließlich
sind aus mangelnder Lebenserfahrung manche Gefahren von ihnen gar nicht
abzuschätzen, erfahrungsgemäß ist die Risikobereitschaft
bei jungen Menschen hoch, etc. So fühle ich mich also nicht immer
gelassen und zuversichtlich. Grundsätzlich wird die Gleichberechtigung
von mir aber nicht mehr in Frage gestellt.
Bei meinen Überlegungen und Handlungen gibt es ein relativ einfaches
Mittel, um festzustellen, auf welcher Schiene ich bin, auf der anordnenden,
pädagogischen oder auf der gleichberechtigten Ebene. Ich frage mich
(oder lasse mich fragen), ob ich so mit meiner Freundin umgehen würde.
Auch das Modell der Kreise von EvB ist ein gutes Überprüfungsmittel:
Jeder Mensch hat einen Kreis um sich, in dem sich die Intimsphäre
und die eigenen Angelegenheiten befinden. Keiner hat das Recht, in den
Kreis des Anderen ohne ausdrückliche Genehmigung einzudringen. Jeder
hat das Recht, den eigenen Kreis zu verteidigen, zu vergrößern
oder auch durchlässig zu machen. Z.B. ist es nicht erlaubt, die Vergrößerung
des eigenen Kreises mit der Forderung zu verknüpfen, der Andere müsse
seinen Kreis auch vergrößern ("Ich mache so viel für Dich,
jetzt mußt Du aber auch..."). Nun sagen aber viele Erwachsene: "Man
muß doch den Kindern Grenzen setzen." Nach diesem Modell kann man
aber immer nur einen Kreis um sich selbst ziehen, nie einen um den anderen
Menschen. Grenzsetzungen sind nur zur Verteidigung der eigenen Grenzen
erlaubt.
Jeden Tag kann man beobachten, wie Menschen, die vorgeben, ihre Kinder
zu lieben, mit ihnen umgehen. Da fällt ein Kind hin, schlägt
sich das Knie auf, wahrscheinlich geht der Strumpf auch noch kaputt. Statt
zu trösten, meckert der "liebende" Erwachsene das weinende Kind auch
noch an. Ein Kind geht im Kaufhausrummel verloren. Statt sich zu freuen,
daß es wieder da ist, macht der Erwachsene Vorwürfe. Oder: Ein
Kind kommt mit einem schlechten Zeugnis nach Hause. Würden die Eltern,
die ihr Kind deshalb fertigmachen, ihrem Freund, der von seinem Arbeitgeber
schlecht beurteilt wird, auch noch zusätzlich Vorwürfe machen?
Oder würden sie ihn trösten und fragen, ob sie helfen können?
Ich höre schon die Einwürfe: das ist doch was ganz anderes,
wir sind schließlich dafür verantwortlich, daß aus dem
Kind was wird, ich bin doch nur so streng, weil ich will, daß mein
Kind eine gute Ausbildung bekommt usw.
Ich kenne diese Sorgen auch, wenn auch immer weniger. Denn
1. zählt die Zeit jetzt auch, oder, wie M. Mead sagt: "Die
Zukunft ist Jetzt!" Das Leben beginnt nicht erst nach dem Schulabschluß,
nach der Ausbildung, nach der abgeschlossenen Karriere.
2. ist mir bekannt, daß Sorgen, Strafen und Druck schlechte
Lehrmeister sind für Entwicklung zur Selbständigkeit, Kreativität,
Kompetenz und Verantwortung sich selbst und anderen gegenüber.
Daß meine Kinder keine Vorschriften von mir bekommen, bringt mir
gelegentlich den Vorwurf ein, ich scheue die Konflikte und würde mich
dadurch beliebt machen wollen. Ja, ich habe es lieber, wenn wir friedlich
miteinander leben, und es gefällt mir, daß wir gut miteinander
klarkommen. Natürlich heißt das nicht, daß wir in allem
einer Meinung sind. Wenn ich einen anderen Standpunkt habe, so reden wir
darüber und ich hoffe (mal mehr, mal weniger), daß meine
Argumente in ihre Überlegungen mit einbezogen werden. Das betrifft
z.B. Schulangelegenheiten, das Nachhausekommen zu einer bestimmten Zeit,
gesundheitliche Fragen wie Ernährung, Schlaf, Rauchen etc. Im Endeffekt
sind das ihre Angelegenheiten, aber ich habe das Bedürfnis, ihnen
meine Gedanken über eventuelle Konsequenzen oder Gefahren mitzuteilen.
Sie wissen, daß ich ihre Entscheidung respektiere. Das hat zur Folge,
daß sie mir nichts vormachen müssen (Was für ein Glück!).
Fragen wie "Erlaubst Du mir, daß ich..." und Antworten wie "Ich erlaube
das nicht." gibt es bei uns nicht mehr.
Bereiche, die in die Öffentlichkeit gehen, fordern zusätzliche
Überlegungen. So werde ich als Erziehungsberechtigte angesprochen,
wenn mein Kind in der Schule fehlt. Hier ist es mit dem Austauch von Argumenten
nicht getan. Ich muß handeln, obwohl es der Zuständigkeitsbereich
des Kindes ist. Im Fall des verweigerten Chemieunterrichtes von Benjamin
habe ich seinem Wunsch entsprochen, zu unterschreiben, daß ich über
sein Fehlen informiert bin und die Verantwortung für die Fehlzeit
übernehme. Ich habe das gemacht, obwohl ich von der Aktion nicht 100%ig
überzeugt war. Aber ich sah, daß Benjamin fest entschlossen
war, diesen Weg zu gehen und die eventuellen Folgen auch zu tragen.
Nun zu den Schwierigkeiten. Es fällt mir nur ein Nachteil ein,
die Erkenntnis, daß Gleichberechtigung nicht auch Gleichverpflichtung
bedeutet. Daran habe ich lange gekaut und tue es manchmal heute noch.
Als die Kinder immer Rechte forderten, wollte ich als "Berechtigung"
ihrer Forderungen, vielleicht auch als Gegengabe, daß sie mehr Pflichten
im Haushalt übernehmen sollten. Ich wollte ihnen nicht mehr sagen
müssen "wasche bitte ab" oder "räume die Sachen weg, auch wenn
sie mal nicht von dir sind" usw. Sie sollten zunehmend nicht nur für
den eigenen, sondern auch für den gemeinsamen Bereich verantwortlich
sein. Ich wünschte mir eine Art von Wohngemeinschaft. Das habe ich
nicht erreicht. Z.B. das leidige Thema Abwasch: Da bin ich manchmal ärgerlich,
daß keiner sieht, daß abgewaschen werden muß. Manchmal
fordere ich zu Abwaschen auf, dann machen sie es. Und meistens mache ich
es selbst. Daß mein Kreis um mich da sehr groß ist, liegt
vielleicht auch daran, daß wir immer drei Wochen zusammenleben und
drei Wochen nicht. Das fördert eine gewisse Großzügigkeit.
Es ist aber meine Entscheidung. Sollte ich mich ausgenutzt fühlen,
was manchmal vorkommt, dann muß ich meinen Kreis enger machen, was
ich auch tue. Und was das Argument angeht: "Später müssen sie
auch...", so weiß ich daß sie es können, wenn sie müssen.
Es ist immer gut, wenn man die Dinge, die man für andere tut,
auch für sich selbst tut. Für mich ist diese Erkenntnis eine
gute Entscheidungshilfe, wenn ich noch nicht sicher bin, ob ich etwas "für
die Kinder" machen soll. So entstehen keine Erwartungen, die leicht zu
Vorwürfen oder Groll führen können. Jeder von uns hat das
Recht zu sagen: ich möchte nicht. Und es wird akzeptiert (na ja, mal
sofort, mal nach Umstimmungsversuchen, aber nie mit Druck, Drohungen oder
länger anhaltender schlechter Laune).
Manchmal bin ich traurig, daß ich mich nicht schon früher
getraut habe, auf Erziehung zu verzichten. Aber besser spät als nie
(oder: "Lieber gleich berechtigt als später")! Was mir dabei geholfen
hat, ist die Tatsache, daß ich mit einem Mann zusammenlebe, der (als
Nicht-Vater vielleicht nicht so ungewöhnlich) keinen Erziehungsanspruch
hatte, ihn aber auch nicht entwickelt hat, mit dem ich alle Sorgen und
Überlegungen besprechen konnte, vor dem ich mich nie rechtfertigen
mußte und der in kritischen Situationen für den Schwächeren
Partei ergriffen hat. Dafür bin ich dankbar, denn ich weiß aus
eigener Erfahrung und von anderen Paaren, daß Streit über den
Umgang mit den Kindern sehr belastend ist. Besonders, wenn man es anders
machen möchte als üblich, braucht man Unterstützung. Und
die habe ich.
Nun noch ein kleiner Ausblick. Immer wieder überrascht und erschreckt
es mich, wenn ich sehe, wie 20-, 30-, 40jährige, die schon längst
selbständig leben, sich von der Beurteilung ihrer Eltern abhängig
fühlen und sie deshalb "schonen", in dem sie nicht aufrichtig zu ihnen
sein können oder sich im Streit abgrenzen müssen und dann Schuldgefühle
haben. Habe ich mir doch auch selbst mit 35 Jahren sehr viel Gedanken darüber
gemacht, wie ich meinen Eltern die Trennung von meinem damaligen Partner
und Vater meiner Kinder möglichst schonend beibringe (als wenn ich
nicht genug andere Sorgen gehabt hätte!).
Als Ergebnis einer guten Eltern-Kinder-Beziehung wünsche ich mir
deshalb, daß sich die Kinder auch später nicht mit un- oder
ausgesprochenen Vorwürfen und Erwartungen herumschlagen müssen
oder nie erreichter Anerkennung hinterherlaufen wollen.
Dagmar Kiesewetter

|