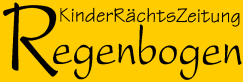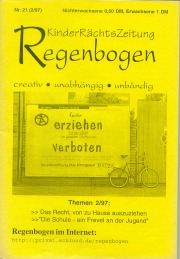<< zurück zur
Ausgaben-Übersicht
Ausgabe 21
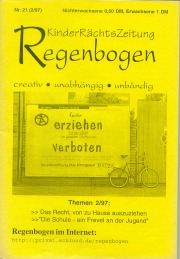

|
Die Schule als Herrschaftsmittel des Staates
Buchrezension über Walther Borgius'
"Die Schule - Ein Frevel an der Jugend"
Walther Borgius machte in seinem Buch schon im Jahre 1930 mit der
oft gehörten Aussage kurzen Prozeß, die Schule sei im Sinne
der jungen Menschen erfunden worden, um sie z.B. vor Kinderarbeit zu schützen
und ihnen das Aneignen sinnvollen Wissens und brauchbarer Fähigkeiten
zu ermöglichen.
In seinem Buch "Die Schule - Ein Frevel an der Jugend" analysiert Dr.
Walther Borgius die Geschichte und die Grundsätze der Schule, seitdem
sie existiert. Er zeigt die Anfänge des Schulwesens auf und macht
dabei überzeugend darauf aufmerksam, daß die Schule immer nur
als Herrschaftsmittel des Staates existierte. Die Schule sei, so Borgius,
"ein ausgezeichnetes Mittel, die Bevölkerung des beherrschten
Territoriums von klein auf zu bequemen Untertanen überhaupt zu drillen.
Was ihnen da gelehrt und beigebracht wurde, war verhältnismäßig
gleichgültig. Die Hauptsache war, daß sie, von Kindesbeinen
an, an widerspruchslosen Gehorsam, geduldiges Stillehalten und Autoritätsglauben
gewöhnt wurden. Stillesitzen, Maulhalten, aufs Wort gehorchen und
blind glauben, was der Erwachsene, geschweige nun gar der Vertreter des
Staates, sagt und lehrt, - das sind die unschätzbaren Errungenschaften,
welche der vieljährige Schulbesuch der Kinder vom Erwachen ersten
Denkens bis zur eigenen Erwerbsfähigkeit dem Staate einträgt."
(S.29)
Borgius geht in seiner messerscharfen Analyse auch darauf ein, mit
welchen Methoden der Schulbetrieb ausgeführt wird. Die jungen Menschen
wurden so sehr verprügelt, daß in Schulgesetzen erstmals Lehrern
vorgeschrieben werden mußte, welche Brutalitäten sie ausführen
durften und welche nicht. Außerdem versuchte man immer den Schuldienst
zeitlich so weit wie möglich auszudehnen, damit die Schüler nur
möglichst wenig Zeit für sich selbst hatten:
"Die Galeere des tagfüllenden Stundenplans, des jahrfüllenden
Klassenpensums ist nicht etwa nur ein notwendiges Übel, eine durch
die leidigen Ansprüche des Lebens erzwungene Unerläßlichkeit,
sondern ein raffiniert erdachtes Mittel zur Erschöpfung der Spannkraft
des Kindes, zur Erdrosselung seiner freien Zeit." (S. 106)
Bis heute ärgern sich Schüler jeden Tag über die viele
vergeudete Zeit, die sie in der Schule einfach nur absitzen müssen.
Was hat nun eine solche Schule für Folgen? Borgius fragt: "Ist
es verwunderlich, daß wir nach generationenlang erduldeter ‘staatlicher
Schuldisziplin’ ein dermaßen verprügeltes unterwürfiges
Volk mit Lakaienseelen geworden sind?" (S. 45). Es kann nicht oft genug
betont werden, daß diese Sätze im Jahre 1930 veröffentlicht
wurden, knapp drei Jahre bevor das unterwürfige Volk einen Diktator
bekommen hat, dessen Gestapo alle noch verbliebenen Exemplare des Buches
"Die Schule - Ein Frevel an der Jugend" sofort nach der Machtergreifung
beschlagnahmte.
Nachdem Borgius die Schulen im späten Mittelalter, während
und nach der Französischen Revolution, unter Bismarck und an vielen
anderen historischen Stationen untersucht, geht Walther Borgius im zweiten
Teil seines Buches ("Grundsätzliches") auch auf die einzelnen Schulfächer
ein und untersucht sie - natürlich - auf ihre Nützlichkeit für
den Staat. So diene beispielsweise die Geographie nur dem "nationalpolitischen
Zweck, der Jugend die Wichtigkeit der Staaten und Staatsgrenzen" zu suggerieren.
Wozu auch sonst, oder ist es vom Standpunkt der "Intelligenz" oder des
"Bildungs"interesses wichtig zu wissen,
"wo etwa nun Assuncion oder Tientsin gelegen ist und an welchem
Flusse Lyon liegt? Wenn dort etwas ‘passiert’, so bringen ja die Zeitungen
ohnehin darüber Mitteilung, meist mit besonderen Kärtchen dazu.
Außerdem aber wird man eben (...) Atlanten bei der Hand haben, aus
denen man sich im Einzelfalle informiert und mit der Zeit von selbst ein
gewisses Anschauungsbild erhält." (S. 142)
In dem Kapitel über die deutsche Sprache schildert Borgius humorvoll,
wie er sich das Lesen mit vier Jahren selbst erlernt hat, bis ihn seine
Eltern einen Nachhilfelehrer auf den Hals jagten, der ihn auch noch mit
dem "ekelhaften kleinen Einmaleins" plagte. Sein Überspringen der
ersten Klasse ersparte ihm auch nicht viel Schulzeit, weil er im Gegenzug
dazu viermal sitzenblieb. Aber Borgius hat natürlich auch zum Deutschunterricht
seine Meinung:
"Zunächst ist es ebenso überflüssig wie schädlich,
den Kindern überhaupt Schreiben und Lesen durch Schulzwang beizubringen.
Die praktische Erfahrung läßt für jeden, der die Augen
aufmachen kann, keinen Zweifel darüber, daß die Kinder ohne
Schulunterricht beides nicht nur ebenfalls, sondern sogar schneller und
besser lernen würden, wenn man ihnen ermöglichte, es statt aufgezwungenen
Drills in bestimmten Stunden, spielend freiwillig voneinander zu lernen,
zu der Zeit, wo bei ihnen das Interesse dafür erwacht." (S. 143)
Es wäre zuviel des Guten, Borgius noch bei seiner Kritik an den
Schulfächern Rechtsschreibung, Naturwissenschaften, Mathematik, Kunst
und Turnen widerzugeben, obwohl gerade letzteres eines nochmals deutlich
macht: Über Jahrhunderte lang hat man "von unten" Turnunterricht gefordert,
weil es gesundheitlich wichtig sei. Der Staat führte das Turnen allerdings
erst ein, als es ein Interesse an der militärischen Tüchtigkeit
des deutschen Volksheeres gab.
Die Argumentation gegen die Abschaffung der Schulpflicht wird von Borgius
aufgegriffen:
"Es gibt nun Leute, welche behaupten: Ohne Zwang würden die
meisten Kinder aber gar nichts leisten, für nichts wirkliches Interesse
zeigen, geschweige denn gar sich realen ernstlichen und anhaltenden Anstrengungen
dafür unterziehen, sondern nur faulenzen und Unfug treiben. Diese
Auffassung (die übrigens allen Beobachtungen widerspricht) kommt mir
immer vor, als behaupte man, die Kinder müßten, da sie ja noch
gar nicht beurteilen vermöchten, was der Körper brauche, fünfmal
täglich zu bestimmten Terminen vorgeschriebene Mahlzeiten von bestimmtem
Ausmaß und bestimmtem Gehalt eingeflößt erhalten, ohne
Rücksicht auf Hunger oder Neigung. Sonst würden alle ‘Suppenkaspers’
werden und elendiglich verhungern.
Solche Pessimisten ignorieren vollständig, daß der Geist
doch genau wie der Körper ein sich naturgemäß entwickelnder
Organismus ist und ganz von selbst dafür Sorge trägt, daß
ihm zugeführt wird, was er zu seiner Entfaltung braucht, einfach durch
den eigenen Drang." (S.169)
Am Schluß des Buches fordert Borgius die "Beseitigung der Schule"
und besteht darauf, dies sei "nicht etwa bloße unfruchtbare Kritik
oder die überspannte Idee eines schulverärgerten Utopisten, sondern
nüchterne Erkenntnis eines schweren Krebsschadens unserer Kultur und
plausibler positiver Vorschlag zu notwendiger Neugestaltung des Jugendlebens".
Diese Neugestaltung hat Borgius allerdings noch nicht deutlich genug ausgearbeitet
(der Autor starb zwei Jahre nach Veröffentlichung seines Buches).
Mir persönlich ist es übrigens egal, ob man die Lerneinrichtungen,
die es nach der Schulpflicht geben wird, noch Schulen nennt oder nicht.
Es wird dann sowieso sehr verschiedene Arten von Bildungshäusern geben,
vielleicht Bildungsgutscheine, vielleicht Schulen, die wie Universitäten
organisiert sind, Schulen wie Summerhill in England und welche, die so
oder so ähnlich funktionieren wie jetzt auch. Es muß bloß
das Grundprinzip gelten, daß niemand zum Lernen gezwungen wird.
Das Argument, Schule sei doch zu guten Zwecken erfunden worden, ist
mit diesem Buch völlig entkräftet. Es ist zwar sowieso nicht
sonderlich überzeugend, heutige Verhältnisse damit zu rechtfertigen,
daß eine solche Handhabung in früherer Zeit durchaus sinnvoll
und gut war, aber trotzdem ist es höchstinteressant, warum die Schule
wirklich erfunden wurde. Nun darf man sich schon das nächste Gegenargument
anhören: "Wenn es früher so schlimm war, dann ist die Schule
heutzutage doch geradezu ein Lernparadies!" Interessanterweise gab es auch
dieses Argument bereits 1930. Borgius jedenfalls schreibt:
"Es ist ein billiger Pharisäismus, jetzt darüber geringschätzig
die Achseln zu zucken und selbstgefällig darauf hinzuweisen, ‘wie
wir’s so herrlich weit gebracht’. (...) aber doch nicht etwa deswegen,
weil der Staat heute seine Interessen zu Gunsten der eigenen Interessen
der Schüler zurückgesetzt hat, sondern weil die Interessen des
Staates heute anders aussehen, weil der Staat der Maschinengewehre und
der Großindustrie und des allgemeinen Wahlrechts keine religiös
verdummte Untertanenschaft mehr braucht, sondern eine naturwissenschaftlich
in wenigstens den Elementen geschulte, gegen die Macht der Kirche durch
antireligiöse Aufklärung immunisierte Wählerschaft und Arbeiterschaft.
Ein krasser Irrtum wäre es, aus diesem Wechsel der realen Staatsinteressen
zu folgern, daß der Staat heute im geringsten weniger, wie ehemals
die Schule zur Drillung bequemer Untertanen mißbraucht." (S.73)
Hinzuzufügen wäre im Jahre 1997, daß die Schule natürlich
menschenfreundlicher geworden ist - allerdings nur quantitativ. Die offensichtliche
Brutalität (z.B. Prügelstrafe) wurde durch subtilere Erziehungsmethoden
(Notengeben, Bloßstellen, "Ordnungsmaßnahmen") ersetzt, Strafe
heißt heutzutage "Motivation" - klingt ja auch schöner. An der
Qualität des Systems aber, am Zwangscharakter der Schule, hat sich,
seitdem es sie gibt, grundsätzlich nichts geändert. Und somit
auch nicht an der Möglichkeit des Staates, sich bequeme Untertanen
heranzuzüchten. Auch wenn es heißt, es sollen kritische, selbständig
denkende Bürger erzogen werden.
Benjamin Kiesewetter

|