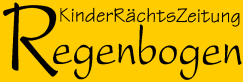 c r e a t i v · u n a b h ä n g i g · u n b ä n d i g |
|
| | Start | Ausgaben | Kontakt | | |
|
<< zurück zur Ausgaben-Übersicht Ausgabe 21 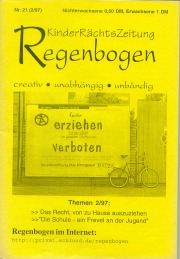 |
Das Recht, von zu Hause auszuziehenKinder in den Keller oder in die Garage einzusperren, erregt - sofern es aufgedeckt wird - völlig zu Recht öffentliches Aufsehen und Empörung, Kinder in der Wohnung einzusperren nicht. Im Gegenteil: Freiheitsberaubung heißt, falls sie bewußt geschieht, "Stubenarrest" und wird von nicht wenigen angewandt, befürwortet oder mindestens toleriert, weil ja sogenannte "erzieherische Erfolge" nicht ausgeschlossen sind. Aber auch ohne, daß es einem bewußt wird, werden Kinder tagtäglich zu Hause eingesperrt, einfach dadurch, daß sie nicht das Recht haben, zu Hause auszuziehen. Die Ursachen, warum Kinder nicht mehr zu Hause leben wollen, sind unterschiedlich.
Vielleicht ist es für die Kinder zweckmäßiger oder einfach
schöner, an einem anderen Ort zu leben. Häufig fühlen sich
die Kinder in der Familie nicht mehr wohl und/oder sind nicht damit einverstanden,
wie sie von Eltern (oder anderen in der Familie lebenden Personen) behandelt
werden und wollen sich dem nun entziehen. Verbietet man Kindern dieses,
so schränkt man ihr Grundrecht auf Freizügigkeit ein. Daß das Kind oder der Jugendliche in eine eigene Wohnung zieht,
ist nur eine von vielen Möglichkeiten - und vermutlich nicht mal die
wahrscheinlichste. Bei gegenseitigem Einverständnis könnte das
Kind z.B. zu anderen Verwandten ziehen, bei der Familie von Freunden wohnen
oder in einer Jugend-WG. Das Recht, zu Hause auszuziehen, ist ein wichtiger Schritt für
mehr Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen. Ihnen dieses Recht
nicht länger vorzuenthalten ist vergleichbar mit der Abschaffung der
Anwesenheitspflicht in der Schule. Solange die Teilnahme an der Schule
bzw. an der Familie nicht freiwillig ist, sind beide nicht wirklich demokratisch,
egal wie gerecht und demokratisch diese beiden Lebensorte intern gestalten
sein mögen. FinanzierungBei der praktischen Umsetzung stellt sich das Problem der Finanzierung. Ideal wäre natürlich ein Recht auf vom Staat bezahlten Wohnraum für jeden einzelnen Menschen, dies ist zur Zeit allerdings wenig aussichtsreich. Eltern sind laut Bürgerlichem Gesetzbuch für ihre Kinder unterhaltspflichtig. In der Praxis wird es allerdings als ausreichend angesehen, wenn sie die Kinder bei sich zu Hause wohnen lassen und dort verpflegen. Die Bestimmung müßte dahin geändert werden, daß Eltern ihren nicht mehr zu Hause lebenden Kindern soviel Geld auszahlen müßten, wie die Kinder auch verbrauchen würden, wenn sie bei ihren Eltern leben würden. Reicht dieses Geld für die Kinder nicht aus, müßte das Sozialamt die Differenz übernehmen. Martin Wilke |