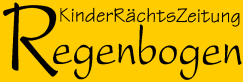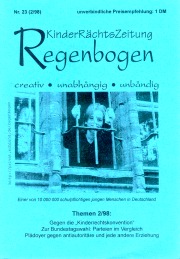<< zurück zur
Ausgaben-Übersicht
Ausgabe 23
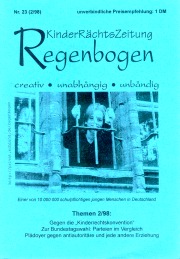

|
Für Kinderrechte heißt gegen die "Kinderrechtskonvention"
Es ist schon etwas paradox: Wer die Gleichberechtigung der Generationen
will, muß erst einmal aus der UN-Kinderrechtskonvention austreten.
Im Jahre 1959, elf Jahre nach der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte,
verfaßte die UNO eine Erklärung zu den Rechten des Kindes. 1979
– im internationalen Jahr des Kindes – schlug die polnische Regierung ein
entsprechendes "Übereinkommen" vor. Dieses wäre verbindliches
Völkerrecht. Nach weiteren zehn Jahren kam schließlich das "Übereinkommen
über die Rechte des Kindes" zustande, das Deutschland Anfang 1992
unterzeichnete.
Dieses Abkommen ist in sich widersprüchlich. An einigen Stellen
ist es ein "Übereinkommen über die Rechte der Eltern und der
Erzieher" und steht im Widerspruch zu grundlegenden Vorstellungen über
Gleichberechtigung. Offenbar geht es in dem Abkommen mehr um klassischen
Kinderschutz als um wirkliche Kinderrechte.
Um eines geht es in dem Übereinkommen jedenfalls nicht: um Gleichberechtigung.
Kinder sollen lediglich etwas mehr Rechte haben als zur Zeit.
Das zeigt sich z.B. in Artikel 12 (1), der oft als der Artikel für
garantierte Mitbestimmung genannt wird. In dem Artikel heißt es lediglich:
"Die Vertragsstaaten (...) berücksichtigen die Meinung des Kindes
angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife". Was angemessen
ist, bestimmen selbstverständlich Erwachsene, ebenso ab welchem Alter
man den Kind überhaupt zuhört und natürlich auch, was als
reif gilt. In der Menschenrechtserklärung hingegen sind die Rechte
gerade nicht abhängig von Fähigkeiten wie "Reife" oder anderen
Bedingungen wie z.B. vom Alter.
Es gibt zwar eine Reihe von Stellen in der Kinderechtskonvention, die
echte Menschenrechte garantieren, so das Recht auf Leben, auf freie Meinungsäußerung,
die Gedanken-, Gewissens- und Glaubensfreiheit, die Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit.
In Artikel 16 (1) wird das Privatleben vor Eingriffen geschützt, wie
auch die Wohnung, der Ruf und die Ehre, in Artikel 19 (1) wird die Gewaltfreiheit
festgeschrieben und in Artikel 40 (2) b 1 daß man solange als unschuldig
gilt, bis die Schuld bewiesen ist (Unschuldsvermutung).
Demgegenüber stehen mehrere Artikel, die den Menschenrechte grundsätzlich
widersprechen. Dazu zählt, daß es laut Artikel 28 (1) Schulpflicht
geben muß, jedenfalls für die Dauer der Grundschule, und die
dauert je nach Land bis zu acht Jahren. Die Schulpflicht stellt u.a. eine
Einschränkung der Menschenrechte auf Freiheit, Freizügigkeit,
Gedankenfreiheit, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Schutz des Privatlebens
vor willkürlichen Eingriffen und der Menschenwürde dar. Allen
Kindern kostenlose Bildung zugänglich zu machen, könnte mit einem
garantierten Recht auf Bildung besser erreicht werden und vor allem ohne
Menschenrechtsverletzungen, vor denen die Kinderrechtskonvention eigentlich
hätte schützen müssen.
In Artikel 32 (2) a wird gefordert, daß es "ein oder mehrere
Mindestalter für die Zulassung zur Arbeit" geben muß, obwohl
das Recht zu arbeiten in Artikel 23 der Menschenrechtserklärung festgeschrieben
ist, die in ihrem Wortlaut Kinder nicht von den Menschenrechten ausschließt.
Artikel 9 des Übereinkommens beraubt Kinder ihres Menschenrechtes
auf Freizügigkeit (Art. 13), indem eine Trennung von den Eltern nicht
gegen deren Willen oder andernfalls nur durch eine Gerichtsentscheidung
möglich ist. Mit einem Recht des Kindes hat dieser Kinderrechtsartikel
nichts zu tun.
Zensur gegenüber Kindern wird durch Artikel 17e legitimiert, in
dem es heißt "Zu diesem Zweck werden die Vertragsstaaten die Erarbeitung
geeigneter Richtlinien zum Schutz des Kindes von Informationen und Material,
die sein Wohlergehen beeinträchtigen, fördern". Auch dieser Artikel
steht in völligem Widerspruch zu dem Prinzip, daß Schutz nicht
Einschränkung von Rechten bedeuten darf.
Und natürlich gibt es auch Widersprüche innerhalb des Werkes.
In der Präambel ist z.B. erst die Rede von voller Entfaltung der Persönlichkeit
des Kindes, kurz darauf wird davon gesprochen, daß es erzogen werden
soll und zwar "im Geiste des Friedens, der Würde, der Toleranz, der
Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität", obwohl all diese Ziele
gerade nicht durch Erziehung zu verwirklichen sind. Anderen Menschen ein
Ziel zu setzen und sie dort – auch gegen deren Willen – hinzuziehen, was
Erziehung ja bedeutet, ist mit Demokratie nicht zu vereinbaren. Artikel
18 schreibt noch mal das Recht der Eltern fest, ihre Kinder zu erziehen
– und das in einem Übereinkommen über die Rechte des Kindes.
Trotz dieser gravierenden Mängel würde sich die rechtliche
Lage von Kindern verbessern, wenn die Kinderrechtskonvention umgesetzt
werden würde, da die genannten Menschenrechtseinschränkungen
in der Praxis ohnehin längst bestehen. Da eine grundlegende Änderung
des "Übereinkommens über die Rechte des Kindes" nicht zu erwarten
ist, muß man aus ihm austreten, um eine wirklich kinder- und menschenfreundliche
Gesellschaft schaffen zu können.
Martin Wilke

|