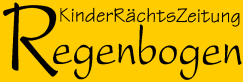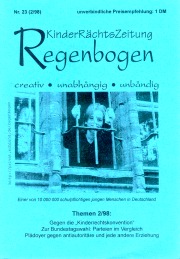<< zurück zur
Ausgaben-Übersicht
Ausgabe 23
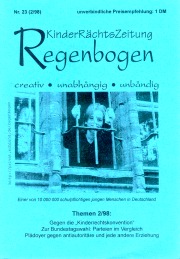

|
Die 68er - Warum wir Jungen sie nicht mehr brauchen
Die 68er und ihre Kinder
Ein Plädoyer gegen antiautoritäre und jede
andere Erziehung
Am 25. Mai ist das Buch "Die 68er - Warum wir Jungen sie nicht mehr
brauchen" erschienen, herausgegeben von der Stiftung für die Rechte
zukünftiger Generationen. In diesem Buch äußert sich zum
ersten Mal in dieser Form die junge Generation zum Thema "30 Jahre 68er".
Wir drucken einen Auszug aus dem Buchbeitrag von Benjamin Kiesewetter.
Viele Erwachsene glauben heute, daß die Idee von einem freieren
Umgang mit Kindern "leider" gescheitert sei. Der Versuch, Kinder ohne Verbote
und Strafen aufwachsen zu lassen, habe desorientierte oder sogar egoistische,
unsoziale Menschen hervorgebracht, die mit ihrem Leben nicht klarkommen.
Und vor allem in der Praxis des Zusammenlebens von Eltern und Kindern habe
sich gezeigt, daß man ohne erzieherische Autorität nicht auskommen
könne.
Ich bin der Meinung, hier einen Denkfehler entdeckt zu haben: Eine
Hauptthese meines Beitrages ist, daß die antiautoritäre Erziehung
nicht wegen antiautoritärem Verhalten gegenüber Kindern gescheitert
ist, sondern wegen des Aufrechterhaltens der Idee, daß man Kinder
weiterhin erziehen müsse. Ich habe meinen Buchbeitrag auf einige Thesen
und Erläuterungen reduziert:
Erziehung ist im Kern eine zutiefst undemokratische und manipulative
Angelegenheit, dies gilt für antiautoritäre Erziehung genauso
wie für jeden autoritäreren Erziehungsansatz. Die Alternative
ist nicht eine andere Erziehung, sondern die Gleichberechtigung zwischen
Eltern und Kindern. Das ist die Abschaffung von Erziehung.
Ein Blick in das Bertelsmann Lexikon verrät: "Erziehung, planmäßige
Tätigkeit zur Formung junger Menschen (...)" Der Erziehungswissenschaftler
Dilthey ergänzt: "Unter Erziehung verstehen wir die planmäßige
Tätigkeit, durch welche die Erwachsenen das Seelenleben von Heranwachsenden
bilden".
Erziehung ist also "planmäßig". Das heißt, sie ist
gezielte, absichtliche (intentionale) Beeinflussung. Erziehung bedeutet,
daß der Erzieher dem Zögling ein Ziel setzt, zu dem der Zögling
gelangen (notfalls "gezogen" werden) soll. Das ist Machtausübung von
oben nach unten: Es gibt immer ein Subjekt und ein Objekt der Erziehung
- einen Erzieher und einen Zögling.
Erziehung richtet sich (im Gegensatz zum Begriff "Lernen") hauptsächlich
nicht an den Verstand des Menschen, sondern an sein "Seelenleben", sie
soll seinen Charakter formen, seinen Willen, sein Gefühl, seine Psyche
(deutsch: "Seele"). Nur wenn einer den anderen zum Guten und Richtigen
bekehren will, wenn der Andere sich ändern (und nicht seine Meinung
überdenken) soll, dann kann man von Erziehung sprechen.
Erziehung bedeutet für den Zögling meistens auch Zwang, weil
das Kind etwas tun oder werden soll, auch wenn es das nicht will. Oftmals
wird es mit Verführung oder mit körperlicher und vor allem psychischer
Gewalt dazu gebracht. Erziehung bedeutet auch dann Zwang für den Zögling,
wenn alles freiwillig und fröhlich zu sein scheint, weil das Kind
im Hintergrund genau die Drohung kennt, was passiert, wenn es nicht mitmacht.
Im Grunde genommen heißt Erziehung, das Kind in seinem So-Sein nicht
zu akzeptieren, zu respektieren oder zu tolerieren, sondern es ändern
(oder "verbessern") zu wollen.
Daraus ergibt sich, daß Erziehung ein intoleranter und vor allem
undemokratischer Vorgang ist. Zur Demokratie gehören unweigerlich
auch die Grundrechte auf Selbst- und Mitbestimmung. Diese Grundrechte werden
durch Erziehung außer Kraft gesetzt.
Auch das Wort "Erziehung" sollte nicht neu besetzt und im Sinne der
Gleichberechtigung verwendet werden, weil es bisher erfolgreich dazu dient,
elterlichen (aber auch z.B. schulischen) Machtmißbrauch gegenüber
Kindern zu verschleiern. Es ist sinnvoll, dies aufzudecken und nicht weiterhin
dafür zu sorgen, daß Erziehung als Synonym dafür steht,
"was für Kinder gut ist".
Der innere Widerspruch zwischen antiautoritärem und gleichzeitig
erzieherischem Verhalten hatte Durcheinander und eine inkonsequente Haltung
von 68er-Eltern zur Folge.
Die 68er haben sicherlich für menschenfreundlichere Beziehungen
zwischen Eltern und Kindern viel getan. Auch wenn heute davon gesprochen
wird, daß die antiautoritäre Erziehung gescheitert sei, so finden
sich doch viele der damaligen Ideen überall wieder und sind praktisch
übernommen worden. Antiautoritäre Erziehung ist also nur als
Ganzes gescheitert. Die Idee der antiautoritären Erziehung ist aber
in sich widersprüchlich. Als eine Folge davon bestehen viele heutige
Eltern-Kind-Beziehungen aus einem Durcheinander an partnerschaftlicher
Haltung, subtilen Erziehungsversuchen und offensichtlichen Machtkämpfen,
bei dem sich weder Kinder noch Eltern wohlfühlen. Wie in so vielen
Bereichen hatten die 68er ganz andere Vorstellungen wie sie mit Kindern
umgehen wollten als sie es dann tatsächlich taten und tun. Der Grund
für dieses Scheitern liegt nicht darin, daß die 68er ihre Ideale
verraten haben. Es war auch nicht die plötzliche Einsichtsfähigkeit
in die Tatsache, daß man ohne Verbote und Strafen mit Kindern nicht
umgehen kann, die das Projekt scheitern ließen. Es war der Widerspruch
zwischen antiautoritärem und gleichzeitig erzieherischem Verhalten,
ein gedankliches Mißverständnis, das bis heute in der Öffentlichkeit
nicht richtig aufgeklärt worden ist.
Das Scheitern antiautoritärer Erziehung hatte aber nicht zur Folge,
daß die 68er-Eltern zu der autoritären Erziehung zurückgegangen
sind, die sie selbst noch in ihrem Elternhaus aushalten mußten. Die
meisten 68er-Eltern haben eine sehr inkonsequente erzieherische Einstellung.
Es besteht zwar der feste Glaube, daß man Kinder erziehen muß,
daß antiautoritäre Erziehung ein gescheitertes Projekt ist und
daß wir wieder pädagogische Grenzen brauchen. Aber wie erzogen
werden soll, weiß keiner genau. Oft geht es ungewollt: mal so, mal
so.
Die faire, konsequent-logische Antwort auf traditionelle Pädagogik
ist nicht Reformpädagogik, sondern Antipädagogik.
Viele Menschen glauben tatsächlich, es sei gar nicht möglich,
nicht zu erziehen. Deswegen setzen sie "Antipädagogik" mit "Antiautoritärer
Erziehung" gleich. Für sie ist Antipädagogik eine Alternativpädagogik.
Als ob man einen Antifaschisten als Alternativfaschisten bezeichnen würde!
Ein Vergleich zwischen Pädagogik, Reformpädagogik und Antipädagogik
zeigt am Thema Grenzen auf, wie sich das Mißverständnis der
antiautoritären Erziehung auswirkte: "Kinder brauchen Grenzen" hieß
eine - wenn nicht sogar die entscheidende - Losung der Pädagogik in
den 90er Jahren. Sie war natürlich auch als Reaktion auf die 68er-Zeit
zu verstehen, in der es hieß, daß sich Kinder dann am besten
entwickeln könnten, wenn man ihnen gar keine Grenzen setze.
Nun wird diese pädagogische Debatte um Grenzsetzungen (ein Euphemismus
übrigens für "Verbote", es hört sich nur schöner an)
auf einem sehr platten und undifferenziertem Niveau geführt. Es gibt
Grenzen, die man (aggressiv) anderen setzt, und es gibt eben Grenzen, die
man (defensiv) zu seinem eigenen Schutz zieht. Diese Unterscheidung wird
von der Öffentlichkeit nicht vorgenommen. Zu einer defensiven Grenzsetzung
gehört z.B. der Satz: "Sei bitte leise, wenn du spät nach Hause
kommst, damit du mich nicht aufweckst." Oder auch: "Laß mich alleine
/ Gehe bitte aus meinem Zimmer." Diese Grenzsetzungen gehören zum
einfachen Notwehrrecht jedes Menschen, sie sind damit demokratisch legitimiert:
Jeder Mensch hat das Recht, sich in der Not zur Wehr zu setzen. Niemand
hat jedoch das demokratisch legitimierte Recht, anderen Menschen aggressive
Grenzen zu setzen.
Nun sind interessanterweise alle pädagogischen Grenzen gleichzeitig
aggressive Grenzen, denn keine pädagogische Grenze wird mit dem Notwehrrecht
begründet. Ganz im Gegenteil sind solche Grenzen dazu da, andere Menschen
"vor sich selbst zu schützen", sie zu ihrem eigenen Glück zu
zwingen. Der Grenzsetzer tut in diesem Fall also so, als wüßte
er besser über des anderen Menschen Glück bescheid. Konsequenterweise
wird er seine Macht dazu benutzen, seine Meinung gerade gegen den Willen
derjenigen Person, für deren Glück er kämpft, durchzusetzen.
Dieser Vorgang, bei dem Kinder wunderbar lernen können, wie gut sich
Gewalt als Mittel zur Durchsetzung von Interessen eignet, ist fast überall
dort Realität, wo Menschen in der Annahme leben, sie müßten
andere Menschen erziehen.
Die Frage, mit der sich ein pädagogisch eingestellter Mensch befaßt,
lautet: Wie muß ich auf das Kind einwirken, daß es so wird,
wie ich es mir vorstelle? Es gibt also Erziehungsziele und Erziehungsmittel,
die erheblich voneinander abweichen. Im Zuge des Wertewandels Ende der
60er Jahre änderte sich das Erziehungsziel, es wurde geradezu in sein
Gegenteil umgekehrt. Hieß es zuvor noch, Kinder müßten
brav, angepaßt und gehorsam werden, so sprach man nun von der "Erziehung
zum kritischen Denken", Ziel war der "mündige Bürger", der selbstbestimmt,
unverklemmt und solidarisch sein sollte. Im Zuge dieser Veränderung
sollte es auch nicht bei den herkömmlichen Erziehungsmitteln bleiben.
Wurden Kinder zuvor fast automatisch belohnt, wenn sie sich wie gewünscht
verhielten und bestraft wenn nicht, so wurde jetzt in den Familien der
Intellektuellen aus (reform-)pädagogischen Gründen zunehmend
auf das Prinzip Belohnung/ Bestrafung verzichtet.
Grundsätzlich veränderte sich gar nichts. Weiterhin war Erziehung
qualitativ durch ein Oben-unten-Denken gekennzeichnet: Die Erzieher setzen
ihren Zöglingen (jetzt: antiautoritäre) Ziele, zu denen sie mit
(jetzt: antiautoritären) Erziehungsmitteln hin"gezogen" werden. Erziehung
bleibt aber Erziehung.
Im Hinblick auf die Grenzen bedeutete das folgendes: Da es nicht vordergründig
darum ging, mit Kindern gleichberechtigte Beziehungen (mit demokratischen
Regeln) zu führen, sondern darum, die genannten (neuen) Ziele an den
Kindern zu verrichten, verzichtete man nicht nur auf die pädagogischen
Grenzen, sondern auch auf die Notwehrgrenzen. Damit die Kinder so würden,
wie sie werden sollten, galt das Erziehungsprinzip der Grenzenlosigkeit.
Dies war der Fehler.
Sobald nämlich dieses Prinzip scheiterte, griff man wieder auf
die pädagogischen Grenzen zurück. Die Alternative, Kinder als
gleichwertige Mitmenschen zu akzeptieren, bei denen man nur dann Grenzen
setzt, wenn man sich selbst eingeschränkt fühlt und von denen
man sich gleichermaßen Grenzen setzen läßt, wurde nicht
gesehen. Stattdessen wunderte man sich darüber, daß so viele
"antiautoritär" aufgewachsenen Kinder Schwierigkeiten damit bekamen,
Schutzgrenzen von anderen Menschen zu akzeptieren.
Durch das Steckenbleiben in der Grundhaltung "Erziehung" haben die emanzipatorischen
Ansätze der 68er nicht gefruchtet. Der Teufelskreis der Erziehung
hat sich fortgesetzt.
Spätestens mit Alice Millers Erkenntnissen gibt es eine sehr überzeugende
psychologische Analyse, die aufzeigt, daß es sich bei Erziehung um
eine Art Teufelskreis handelt. Auf eine allgemeine Formel gebracht bedeuten
ihre Erkenntnisse: Die Kinder müssen die Gemeinheiten ihrer Eltern
solange ertragen, bis sie sie mit ihren eigenen Kindern wiederholen. Der
allgemeine Glaube, daß man Kinder erziehen muß, pflanzt sich
so durch die Anwendung von Erziehung von Generation zu Generation fort.
Der genannte Teufelskreis ist glücklicherweise nicht unüberwindbar.
Es schlagen schließlich nicht alle geschlagenen Kinder ihre eigenen
Kinder. Und so war es eins der zentralen Ziele der 68er-Pädagogik,
aus diesem Teufelskreis auszubrechen. An den 68er-Eltern von heute kann
man unschwer erkennen, daß dieses Ausbrechen nicht grundsätzlich
gelungen ist. Vielmehr läßt sich das beobachten, was vorher
auch schon der Fall war: Auch die 68er-Eltern wiederholen die Fehler, die
schon ihre eigenen Eltern gemacht haben.
Zwar gibt es sicherlich wenige 68er-Eltern, die ihre Kinder schlagen,
obwohl viele von ihnen in ihrer Kindheit Schläge bekommen haben. Trotzdem
stecken die allermeisten 68er in den Denkmustern von Verbieten (und damit:
Erlauben), Bestrafen (und damit: Belohnen) drin. Und das ist kein Wunder:
Die 68er haben nicht erkannt, daß Pädagogik und Erziehung -
besser vielleicht: pädagogischer und erzieherischer Umgang mit Kindern
- nicht verbessert oder reformiert, sondern abgeschafft werden müssen.
Es bedarf keiner Reformpädagogik, sondern einer Negation der Pädagogik
(=Antipädagogik).
Mit der antiautoritären Erziehung hat man sich von den Voraussetzungen
der Erziehung nicht verabschiedet. Mittel und Ziele der Erziehung sollten
sich ändern, das Oben-unten-Denken aber, die zwangsläufige Aufteilung
in Subjekt und Objekt, blieb bestehen.
So hatte das Scheitern antiautoritärer Erziehung zur Folge, daß
viele 68er-Eltern wieder auf die traditionelle Erziehung zurückgriffen.
Aus dem Scheitern der antiautoritären Erziehung sind die falschen
Schlüsse gezogen worden. Heute wird wieder eine konsequentere und
autoritärere Erziehung gefordert, weil die Alternative nicht gesehen
wird, mit der Erziehung ganz aufzuhören und mit jungen Menschen gleichberechtigte
Beziehungen zu führen.
Dabei wird gerade in der Werteerziehungs-Debatte viel gedanklicher
Unsinn produziert. So versucht man, mit undemokratischen Mitteln (Erziehung),
demokratische Werte zu vermitteln, ungeachtet der Tatsache, daß auch
dieser Versuch an seinem inneren Widerspruch zum Scheitern verurteilt ist.
Dabei ist es so einfach: Demokratische Werte, die gelebt werden, brauchen
nicht gepredigt oder gar anerzogen zu werden.
Durch Erziehung erreicht man nicht, daß Menschen demokratische
Werte annehmen und wichtig finden. Falls es ein Erzogener trotzdem tut,
so liegt es nicht an der Erziehung, sondern an den Erfahrungen, die der
Mensch außerhalb der Erziehung gemacht hat. Durch Erziehung erreicht
man eher das Gegenteil: Denn die Sympathie gegenüber Werten verringert
sich schon dann beträchtlich, wenn man sie ständig gepredigt
bekommt und jemand versucht, sie anzuerziehen. Kindern und Jugendlichen
werden immer die Mittel der Erziehung im Blut bleiben - und die können
nun mal nicht demokratisch sein. Damit Erziehung funktioniert, muß
das Ziel den gleichen Inhalt haben wie das Mittel (es muß also auch
undemokratisch sein).
Wer demokratische Ziele hat, muß auch demokratische Mittel finden,
sie durchzusetzen. Er muß sich von Erziehung verabschieden.
Benjamin Kiesewetter

|