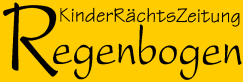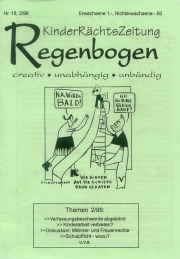<< zurück zur
Ausgaben-Übersicht
Ausgabe 18
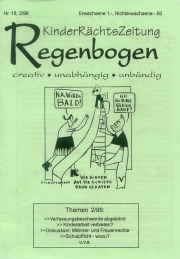

|
Verfassungsbeschwerde nicht angenommen
Entscheidung des Gerichts juristisch bedenklich
Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde zweier
Schüler wegen Vorenthaltung des Wahlrechts nicht zur Verhandlung angenommen
(2 BvR 1917/95).
Der in der Klageschrift erhobene Vorwurf eines inneren Widerspruchs
in der Verfassung wurde nicht zur Verhandlung zugelassen, da die Frist
für eine solche Beschwerde abgelaufen sei. Im §93(3) Bundesverfassungsgerichtsgesetz
(BVerfGG) mit dem das Gericht die Nichtannahme begründet, heißt
es: "Richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz oder
gegen einen sonstigen Hoheitsakt, gegen den der Rechtweg nicht offen steht
(...)" kann sie "nur binnen eines Jahres erhoben werden."
Diese Argumentation hält der bevollmächtigte Anwalt Dr. Peter
Merk für juristisch nicht tragfähig, da die Beschwerde weder
ein Gesetz noch einen "sonstigen Hoheitsakt" angreife, sondern
vielmehr die Verfassung selbst. Der in § 93(3) verwandte Begriff "Gesetz"
könne nicht so verstanden werden, daß er auch das Grundgesetz
- also die Verfassung - umfaßt, weil das Grundgesetz die Grundlage
der Gesetze erschaffe, d.h. Bedingung aller Gesetze sei. Auch Hoheitsakte
setzten eine staatliche Organisation voraus, die wiederum eine Verfassung
zur Voraussetzung haben müsse. Folglich könne das Grundgesetz
nicht selbst ein Hoheitsakt sein.
Im Übrigen begründet das Gericht seine Ablehnung mit einem Verfassungsgerichtsurteil,
in dem es um ein Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes ging. Das habe
aber nach Ansicht Merks mit dem aktuellen Fall nichts zu tun, da jetzt
"gegen eine Norm des Grundgesetzes selbst in ihrem ursprünglichen
Bestand" geklagt wurde.
Das Gericht vertrete somit einen Standpunkt, der eine juristische Änderung
des Grundgesetzes durch Verfassungsbeschwerden von vornherein ausschließt.
Es könne hier die Frage aufgeworfen werden, ob das Gericht nicht durch
die Verweigerung der Verhandlung gegen Art. 19 (4) des Grundgesetzes verstoße
("Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten
verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen."). Zweifelsfrei seien
die Beschwerdeführer durch die öffentliche Gewalt in ihren Rechten
verletzt, indem sie durch eine Norm des Grundgesetzes von der Ausübung
eines Grundrechts, nämlich des politischen Grundrechts der Wahl, vollständig
ausgeschlossen würden, so der Anwalt.
"Die Entscheidung bedeutet ja, daß wir die Klage bereits
1952 hätten einreichen müssen." sagt der Beschwerdeführer
Benjamin Kiesewetter. Trotz allem dürfe nicht vergessen werden, daß
ein Hauptziel der Verfassungsbeschwerde - der Beginn einer öffentlichen
Diskussion - erreicht sei. In diesem Sinne müsse nach Meinung der
Kinderrechtgruppe die Auseinandersetzung um das Wahlrecht ohne Altergrenze
fortgesetzt werden, da der Forderung und Argumentation der Kinderrechtler
vom Gericht inhaltlich nichts entgegengesetzt worden sei.
Nach der Ablehnung titelte die Zeitschrift klein & groß nun:
"Ein Mensch - Keine Stimme". Auch viele Unterstützer zeigten
sich enttäuscht von der formalen Ablehnung.
Wie geht es nun weiter ist die zentrale Frage, die die KinderRÄchTsZÄnker
jetzt beschäftigt. Dabei fallen zwei verschiedene Möglichkeiten
ins Gewicht: "Wir könnten gegen die neue Berliner Verfassung
klagen, die erst seit Oktober 1995 gültig ist. Hier ist die Jahresfrist
noch nicht abgelaufen. Ebenfalls könnte man gegen die niedersächsische
Verfassung klagen, weil die Änderung mit der das Kommunalwahlrecht
ab 16 beschlossen worden ist, auch erst einige Monate her ist. Und schließlich
ist die Vorenthaltung des Wahlrechts für Unter-16jährige genauso
ungerecht".
Hier sei allerdings abzuwägen, daß das Verfassungsgericht immer
wieder "Ausreden" finden könnte, warum die Beschwerde nicht
zur Verhandlung angenommen werden sollte. Deshalb schlägt Dr. Merk
eine andere Variante vor: "Einige Jugendliche, die bei der nächsten
Wahl noch nicht 18 sind, beantragen die Aufnahme in die Wählerlisten.
Das wird - aufgrund des Alters - natürlich abgelehnt." Dagegen
würden die Zänker dann beim Verwaltungsgericht klagen, die verpflichtet
sind, eine solche Klage anzunehmen. Wird hier wieder abgelehnt, geht es
zum Oberverwaltungsgericht, Bundesverwaltungsgericht usw. "Durch die
Instanzen durchgeklagt landen wir dann wieder beim Bundesverfassungsgericht
- die Jahresfrist hätten wir damit wieder umgangen" so der Beschwerdeführer
Rainer Kintzel. Problem Nummer 1 für Folgeaktionen ist das Geld: Nachdem
die ersten 25.000 DM bei der ersten Klage draufgegangen sind, fehlen nun
wieder ca. 30.000, um sich durch die Instanzen zu klagen. Für dieses
Problem ist bisher keine Lösung in Sicht. Benjamin Kiesewetter: "Es
soll doch aber nicht am Geld scheitern, oder?"
- ANZEIGE -
Wir trauern um
Die Demokratie
ermordet am 08.01.1996 n. Chr.,
als der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts die Verfassungsbeschwerde
zur Vollendung des demokratischen Prinzips der Gleichberechtigung nicht
zur Verhandlung annahm.
In tiefer Trauer und Depression: Benjamin Kiesewetter und die Kinderrächtszänker
Pressemitteilung
Fragen und Antworten (FAQ) zum Kinderwahlrecht

|